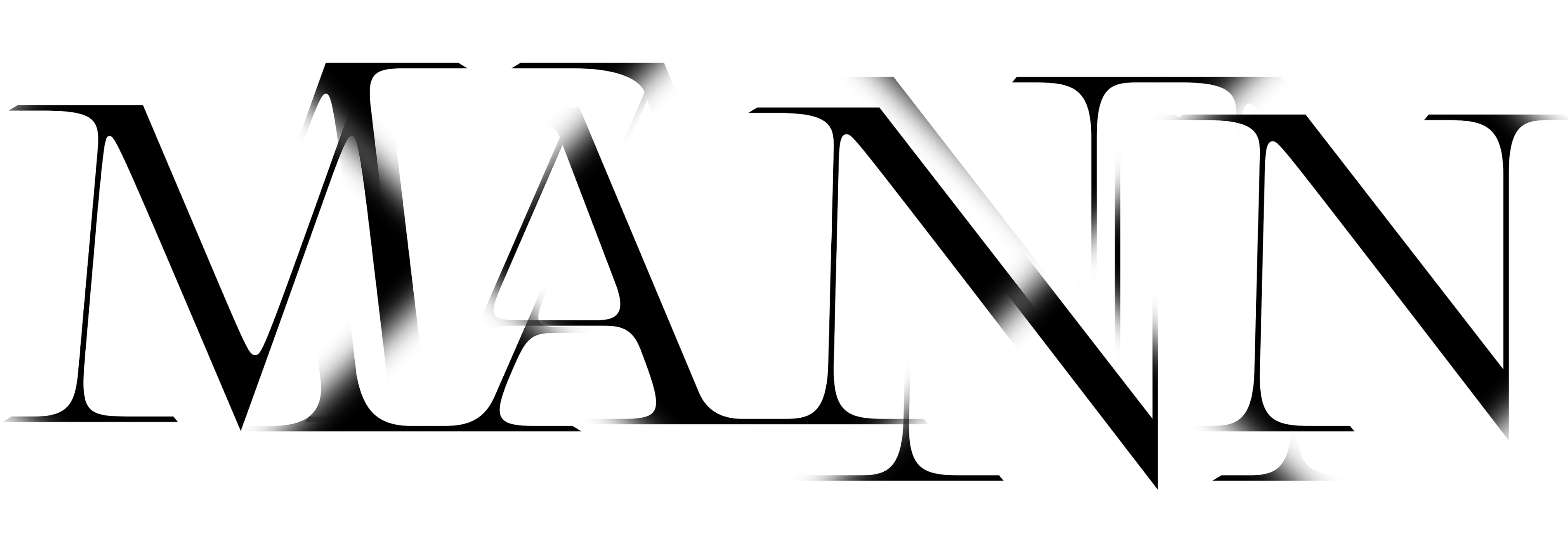Die Platte wird in ein Flugzeug geladen, nach New York geflogen, wird dort per Telefon – durch ein Unterseekabel – nach London übertragen, ein zweites Mal auf Platte gepresst und schließlich auf Langwelle ausgestrahlt. Eine technische Odyssee über zwei Kontinente und einen Ozean, damit eine Stimme nach Deutschland gelangt. Dort, wo sie gehört werden soll, ist das ein „Rundfunkverbrechen", das mit Zuchthaus oder gar dem Tod bestraft werden kann. Wer seinen Volksempfänger trotzdem auf die BBC einstellt, hört die sonore Stimme eines Mannes, der sein Land verlassen musste und nun aus der Ferne zu retten versucht, was zu retten ist: eine Idee von Deutschland, die mit der Wirklichkeit des Dritten Reiches nichts mehr gemein hat.
Zum 150. Geburtstags ist es Zeit, jene 59 kurzen Radioansprachen neu zu entdecken, die er zwischen 1940 und 1945 über die BBC ins nationalsozialistische Deutschland sendete. Der Deutschlandfunk widmete ihnen eine „Lange Nacht", Kommentatoren von Alice Hasters bis Navid Kermani hören die alten Aufnahmen ab. Was sie hören, ist mehr als ein historisches Dokument. Es ist die Frage, ob Literatur gegen Gewalt ankommen kann – und welchen Preis der Versuch kostet.
Der Unpolitische wird politisch
Dass ausgerechnet Thomas Mann zur Stimme des „anderen Deutschland" wurde, ist keine Selbstverständlichkeit. In seinen Betrachtungen eines Unpolitischen von 1918 hatte er die Trennung von Geist und Politik beschworen, den „Zivilisationsliteraten" verachtet, der seine Kunst in den Dienst politischer Zwecke stellt. Doch die Weimarer Republik zwang ihn zur Revision. Die Ermordung Walther Rathenaus 1922, der Aufstieg der Nationalsozialisten, schließlich die Emigration 1933 – jeder Schritt führte den Schriftsteller tiefer in das Feld, das er einst gemieden hatte.
Als die BBC 1940 anfragte, zögerte er. Propaganda? Er, der Stilist? Zunächst schickte er seine Texte per Telegramm nach London, wo sie ein BBC-Sprecher verlas. Doch das genügte ihm nicht. Ab März 1941 bestand er darauf, selbst zu sprechen – trotz des umständlichen Verfahrens über drei Stationen. Er erkannte die Chance: „Auch war es verlockend, einmal wieder in dem Bewusstsein Deutsch zu schreiben, dass das Geschriebene in seiner angeborenen Gestalt, auf Deutsch werde wirken dürfen." Die Reden kommentierten Stalingrad und Coventry, den Holocaust und Hitlers Kriegszüge. Sie waren Teil der psychologischen Kriegsführung Großbritanniens – und zugleich ein moralischer "Gewissensdienst", wie Mann es nannte. Ein Widerspruch? Vielleicht. Aber einer, mit dem er leben musste.
Die Verantwortlichen der BBC fanden Manns Ton bisweilen zu scharf. Sie verfolgte eine „Strategie der Wahrheit" und wollte den Propagandalügen der Nazis nicht mit Polemik begegnen. Begriffe wie „blutige Banause", „Verräterpack" oder „blutige Halunken" wurden vom zuständigen Redaktor auf den Index gesetzt. Thomas Mann kümmerte sich nicht darum. Und man ließ es ihm durchgehen.
„Dem, der heute wieder zu euch spricht"
November 1941: „Dem, der heute wieder zu euch spricht, war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschlands einiges zu tun. Ich bin dankbar dafür, aber ich habe kein Recht, mich dessen zu rühmen, denn es war Fügung und lag nicht in meiner Absicht."
Diese Sätze – selbstironisch, bescheiden, aber durchaus seiner Autorität bewusst – sind typisch für Manns Rhetorik. Er spricht nicht von oben herab, aber auch nicht auf Augenhöhe. Er spricht als einer, der das Recht verloren hat, sich auf seine Leistungen zu berufen, und es gerade deshalb tut. Alice Hasters findet darin eine „schmerzhafte Klarheit". Man müsse, sagt sie, „in dieser realen Härte auch mit einer harten Sprache antworten". Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff betont, Mann habe früh verstanden, dass jede Hierarchisierung von Völkern in die Barbarei führe. Was in den vierziger Jahren eine Provokation war, liest sich heute wie eine Selbstverständlichkeit – und ist es doch nicht.
Aber nicht alle sind einverstanden mit Manns Ton. Feridun Zaimoglu vermisst „Wortgewandtheit, Wortwitz". Ihm ist das zu viel „eindreschen auf den Mann Hitler", zu wenig direkte Ansprache der Menschen. Zaimoglu stellt eine wichtige Frage: Kann man autoritäre Verführer mit Ironie entwaffnen? Oder braucht es die moralische Keule? Mann wählte meist die zweite Option – und bezahlte dafür einen Preis. Die Wirkung seiner Reden blieb begrenzt. Wer sie hörte, war meist schon überzeugt. Wer überzeugt werden sollte, hörte sie nicht.
Coventry und die Maschinisten des Todes
„Zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von Coventry durch Görings Flieger – einer der schauderhaftesten Leistungen, mit denen Hitler-Deutschland die Welt belehrte, was der totale Krieg ist." Mann spricht diese Worte mit einer Mischung aus Zorn und Trauer. Er erinnert an den Spanischen Bürgerkrieg als „Vorübung", geißelt die „nationalsozialistisch erzogene Rasse mit den leeren, entmenschten Gesichtern". Das Vokabular ist hart, manchmal nahe an der Propaganda, die es bekämpft. Aber Mann weiß, was er tut. Er trauert, sagt Mely Kiyak. Trauert um Europa, um Deutschland, um die Zivilisation selbst.
Michel Friedman hört noch etwas anderes heraus: die „klare Einsicht in die Unsühnbarkeit dessen, was ein von schändlichen Lehrmeistern zur Bestialität geschultes Deutschland der Menschheit angetan hat". Friedman insistiert darauf, dass Mann die Schuld beim Namen nennt und Reue einfordert. „Umkehr und Reue ist das Erste, was not tut. Und nur ein Hass tut not: der auf die Schurken, die den deutschen Namen vor Gott und der ganzen Welt zum Gräuel gemacht haben." Dieser Satz – „nur ein Hass tut not" – ist verstörend und notwendig zugleich. Er zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen moralischer Klarheit und moralischer Selbstgerechtigkeit.
Die singuläre Autorität
Navid Kermani findet die vielleicht treffendsten Worte für das Phänomen Thomas Mann: „Er hat eine unglaubliche, eigentlich eine einzigartige Bedeutung gewonnen. Diese Position eines Intellektuellen, die hat es seitdem gar nicht mehr geben können." Was Kermani meint, ist nicht nur die literarische Größe, sondern etwas Geschichtliches: Mann wurde in einer Stunde extremster Zuspitzung zur moralischen Instanz, weil er Literatur und Politik, Ästhetik und Ethik zusammenzwang. Nach ihm gab es engagierte Schriftsteller – Grass, Böll, Enzensberger –, aber keinen mehr, der mit ähnlicher Autorität sprechen konnte. Die Zeit der großen Intellektuellen, so scheint es, ist vorbei. Oder sie hat sich aufgesplittert in viele Stimmen, die zusammen nicht mehr das Gewicht einer einzigen haben.
Kermanis Würdigung zeigt noch etwas anderes: Manns Reden sprechen auch zu Menschen mit transkulturellen Biografien, weil sie grundlegende Fragen der Menschlichkeit verhandeln. Das macht sie universal – und zugleich spezifisch deutsch, denn sie kreisen unablässig um die Frage, was Deutschland war, ist und sein könnte.
Die „Lange Nacht“ versammelt eine Vielzahl von Stimmen und Kommentaren zu Manns Reden. Raul Krauthausen und Arne Friedrich betonen die Aktualität des Appells gegen Totalitarismus und für Solidarität. Nicola Leibinger Kammüller bekennt: „Ich liebe Thomas Mann“ – für sie ist die klare Verteidigung der Demokratie heute noch lehrreich.
Die Vielfalt der Reaktionen zeigt: Die BBC Reden sind nicht bloß historische Dokumente. Sie stellen uns Fragen: Wie sprechen wir über Krieg und Frieden, Schuld und Verantwortung? Welche Sprache brauchen wir, um Hass zu entlarven, ohne selbst hasserfüllt zu werden? Wie viel moralische Strenge ist nötig, und wo verlangt die Zeit nach Empathie und Witz?
Das Echo im Heute
Die BBC-Reden sind ein Paradox. Sie wollten wirken im Augenblick – und wirkten damals doch kaum. Heute, achtzig Jahre später, wirken sie stärker als je zuvor. Das liegt nicht nur an der Qualität der Texte, sondern auch an unserer Zeit. Wenn Populismus und Autoritarismus wieder erstarken, wenn Desinformation zur Waffe wird und Demokratien fragil erscheinen, dann klingen Manns Worte nicht historisch, sondern hellsichtig.
Manns Stimme über dem Atlantik war ein Versuch, die Macht der Literatur gegen die Macht der Gewalt zu setzen. Es war ein ungleicher Kampf, und Mann wusste das. Aber er führte ihn trotzdem. „Deutsche Hörer!" – dieser Ruf gilt noch immer, über alle Grenzen hinweg. Nicht als Anklage, sondern als Erinnerung daran, dass es möglich ist, das Wort zu ergreifen, wenn das Schweigen unerträglich wird. Das ist keine Garantie für Erfolg. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die Würde zu bewahren.
Im S. Fischer Verlag ist unter dem Titel Deutsche Hörer! eine Neuausgabe der Radioansprachen mit einem Vorwort und einem Nachwort von Mely Kiyak erschienen.
Ein Projekt in Zusammenarbeit mit Sonja Valentin und Hans Dieter Heimendahl, Deutschlandradio Kultur.