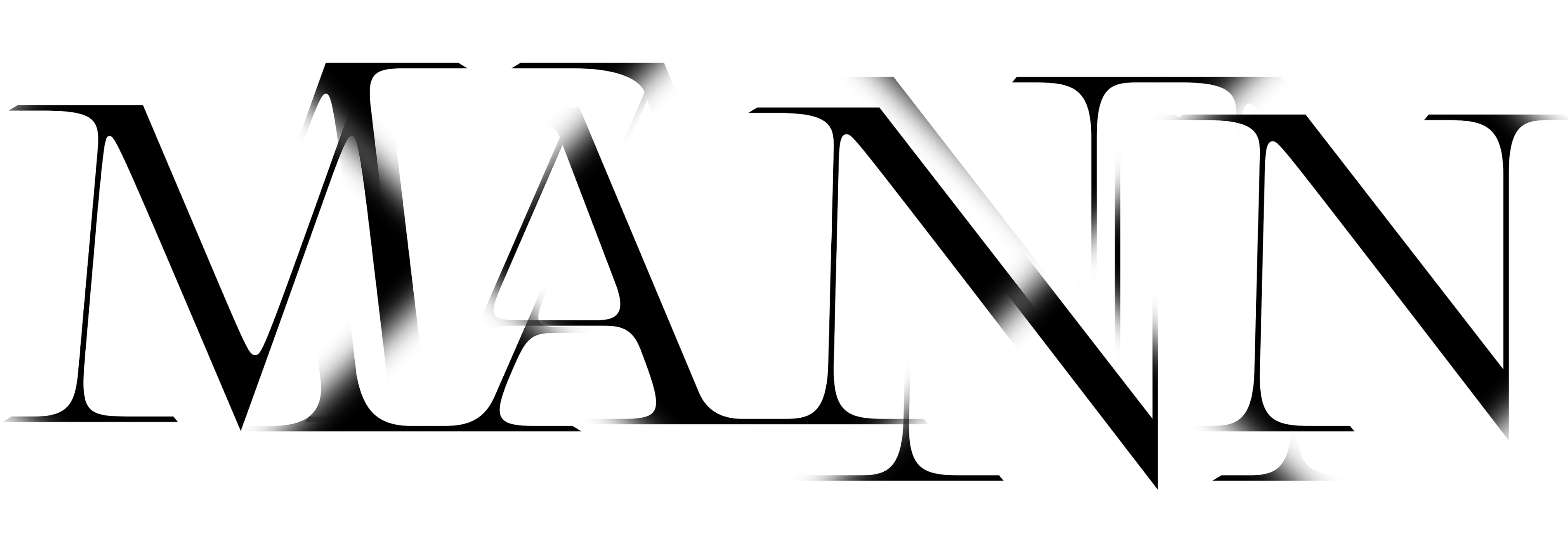Als Thomas Mann im Oktober 1930 im Berliner Beethoven-Saal seine Deutsche Ansprache hielt, waren erst wenige Wochen vergangen, seit die NSDAP bei den Reichstagswahlen von 3 auf 18 Prozent gestiegen war. Der sonst distanzierte Schriftsteller sah sich gezwungen, öffentlich das Wort zu ergreifen, Position zu beziehen. Eindringlich warnte er vor der nationalsozialistischen Bewegung und appellierte an Vernunft und Humanität. Für ihn stand fest, es gab „Stunden, Augenblicke … in denen der Künstler … nicht weiter kann, weil … eine krisenhafte Bedrängnis der Allgemeinheit auch ihn auf eine Weise erschüttert, daß die spielend leidenschaftliche Vertiefung ins Ewig-Menschliche, die man Kunst nennt, zur seelischen Unmöglichkeit wird.“ Schon während der Rede wurde er von SA-Männern mit Zwischenrufen attackiert. Eine Szene, die wie ein Menetekel wirkte: Gereiztheit, Aggression, eine Gesellschaft am Rande des Zerfalls.
Knapp hundert Jahre später wurde diese historische Situation im Rahmen des Beethovenfests in Bonn aufgegriffen. "Alles scheint erlaubt gegen den Menschenanstand" oder "Die große Gereiztheit", lautete der programmatische Titel der Veranstaltung. Stipendiat:innen des Thomas Mann Fellowships diskutierten die Frage: Was hat der Autor des Zauberberg unserer Gegenwart zu sagen?
Luisa Imorde spielte zu Beginn die Arietta aus Beethovens op. 111 – jenes Werk, das Thomas Mann im Doktor Faustus zur Metapher für gesprengte klassische Formen machte und zu einem Symbol für das Ende einer Epoche.
Die große Gereiztheit
Als erster erinnerte Friedhelm Marx an die Doppelgestalt des Begriffs "Gereiztheit" bei Thomas Mann. Im Zauberberg erscheint sie als ein brodelndes gesellschaftliches Grundgefühl, das auf die Katastrophe des Ersten Weltkriegs zuläuft. In der Berliner Rede wird sie zur Diagnose einer Gesellschaft, die sich in Aggression und Ressentiment verstrickt. "Mann verweigert einfache Antworten", so Marx. "Die große Gereiztheit kann Vorbote einer Katastrophe sein, sie kann aber auch in sich zusammenfallen, aus Erschöpfung, aus Überdruss. Diese Offenheit macht seine Texte so aktuell."
Polarisierung als Struktur
Nils C. Kumkar übersetzte diese Diagnose in die Sprache der Soziologie. Polarisierung, so erklärte er, sei in Demokratien kein Ausnahmezustand, sondern strukturell normal – das Spannungsverhältnis von Regierung und Opposition. "Das Neue ist, dass die extreme Rechte es geschafft hat, in diesem Spiel einen festen Pol zu besetzen. Heute kann über Gesellschaft kaum gesprochen werden, ohne sich zu fragen, was die extreme Rechte damit macht." Für Kumkar ist das die eigentliche Gefahr: nicht Gereiztheit an sich, sondern die Dominanz, die durch den rechten Pol entsteht.
Mut im richtigen Moment
Für Steven Walter, Intendant des Beethovenfests, war die Aktualität Thomas Manns vor allem eine Frage der Haltung. "Thomas Mann war ein Ninja der Worte, ein Schachtelsatzkiller, ein Sniper mit Adverbien", und der Schriftsteller habe diese sprachliche Macht 1930 gegen SA-Störer eingesetzt. Schon als Jugendlicher habe ihn Tonio Kröger "gecatcht". Heute fasziniere ihn, dass Mann im entscheidenden Moment nicht schwieg, sondern etwas riskierte. "Trotz privilegierter Lebensumstände hat er das Risiko auf sich genommen, öffentlich gegen den Nationalsozialismus aufzutreten. Viele andere haben das nicht geschafft. Die Frage ist: Wo ist heute der Moment, wo man etwas tun muss?"
Die Konstruktion einer Ikone: Wer ist „unser“ Thomas Mann?
Die Kulturjournalistin Aida Baghernejad öffnete eine meta-reflexive Ebene: "Über welchen Thomas Mann sprechen wir eigentlich, wenn wir ihn heute feiern? Den Ästheten, den Bürger, den Antifaschisten?" Für sie ist es eine gesellschaftliche Entscheidung, ob man an Texte wie die Deutsche Ansprache oder den offenen Brief Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre erinnert – oder ob man sich nur an der sprachlichen Schönheit der Buddenbrooks erfreut. Gerade im Jahr des 150. Geburtstags gehe es darum, den Autor in seiner Widersprüchlichkeit ernst zu nehmen.
Durcharbeiten statt Erweckung
Im Verlauf der Diskussion, moderiert von Andreas Platthaus (FAZ), erinnerte Marx daran, dass der monarchistische Mann der Betrachtungen eines Unpolitischen nie ganz verschwand. Kumkar deutete das als Beleg, dass politische Haltungen nicht ex nihilo entstehen, sondern durch ständige Neujustierung. Manns Politisierung sei ein „Durcharbeiten“ gewesen – eine Form, die auch für heutige demokratische Prozesse lehrreich sei. "Der monarchistische Thomas Mann verschwindet nicht einfach. Politisierung ist ein Gruppensport. Bei Thomas Mann waren seine Kinder, sein Bruder, seine Tochter ganz wichtig. Demokratie ist ein Gruppensport."
Der gesprengte Roman
Besonders intensiv diskutiert wurde Doktor Faustus, der große Roman des Exils. Hier verband Mann Musik, Literatur und Politik – und arbeitete zugleich die deutsche Romantik auf, die in hysterische Barbarei umgeschlagen war. Lange als überambitioniert kritisiert, wird der Roman heute neu gelesen: als Versuch, die kulturellen Wurzeln des Nationalsozialismus literarisch zu fassen. "Er sprengt die Form, so wie Beethoven die Sonate sprengte", sagte Marx. "Thomas Mann wollte zeigen, dass das, was sich zwischen 1933 und 1945 ereignet hat, eine Vorgeschichte hat. Das war kein Betriebsunfall der deutschen Geschichte." In Deutschland habe der Roman zunächst keine Erfolgsgeschichte geschrieben – "weil man das nicht hören wollte."
Das Haus der offenen Türen
Walter berichtete auch von seiner Zeit in Pacific Palisades. "Ich habe mir die Aufgabe gegeben, die Türen weit aufzureißen und möglichst viele Menschen einzuladen. Jeder konnte mit Thomas Mann etwas anfangen. Ich hatte nicht gedacht, dass das Transatlantische wieder so wichtig wird."
Das Haus diene heute als Resonanzraum – für Erinnerung, aber auch für aktuelle Debatten über gefährdete Demokratie.
Zum Abschluss stellte Platthaus den Fellows die Frage: Welche Thomas-Mann-Texte begleiten sie?
Baghernejad wählte die politischen Reden: "Das Zuhause ist immer das Dagegen-Sein und Hadern. Zu sehen, dass auch eine Geistesgröße sich in diesem Hadern eingerichtet hatte – das ist ein Trost."
Walter kehrte zu den Buddenbrooks zurück: "Das erste Mal unter Palmen in Kalifornien gelesen – das war ein Full-Circle-Moment."
Kumkar entschied sich für Mario und der Zauberer: "Wegen der frühen Beobachtung faschistischer Tendenzen und der Verführungskraft des Autoritären."
Marx bekannte sich zum Zauberberg: "Der hat so eine stehende Atmosphäre, da fühle ich mich zu Hause."
Die Verweigerung der einfachen Antwort
Als Luisa Imorde zum Abschluss noch einmal die Arietta spielte, hallte Marx' zentrale Erkenntnis nach: "Mann verweigert einfache Antworten. Die große Gereiztheit kann Vorbote einer Katastrophe sein, sie kann aber auch in sich zusammenfallen – aus Erschöpfung, aus Überdruss. Diese Offenheit macht seine Texte so aktuell."
Vielleicht liegt darin die Antwort auf Baghernejads Eingangsfrage: Wir brauchen nicht den einen Thomas Mann, sondern all seine Facetten – den Ästheten wie den Kämpfer, den Zweifler wie den Überzeugten. Seine Texte zwingen uns, immer wieder neu zu entscheiden, wo wir stehen.
Ein Abend, wie er Thomas Mann gefallen hätte: mit mehr Fragen als Antworten – und mit der Gewissheit, dass das Fragen selbst schon ein Anfang ist.