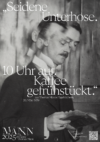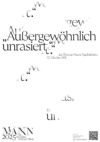„Große Abneigung, nachmittags noch irgendwas zu tun“ war einer der beliebtesten Tweets auf deinem Account. Was sagt das über die Twitter-Nutzer von vor zwei Jahren aus?
Ich glaube, das kommt aus einer Überraschung heraus. Einerseits wegen unserer Vorstellung von Dichtern und Geistesgrößen, die nicht totzukriegen ist – und in den letzten Jahren sogar noch zugenommen hat. Das Genie ist wieder total präsent in den Medien. Frag mal Leute auf der Straße „Wofür ist Thomas Mann bekannt?“ – die sagen dir alle: für seine unendliche Disziplin. Das ist eine der erfolgreichsten Marketingstrategien der deutschen Literaturgeschichte.
Dann gibt es da natürlich auch eine ‚Relatability‘. Der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen würde das wahrscheinlich als ‚späte Rache‘ der Leser sehen, die Thomas Mann als Schullektüre hatten – so eine aufgestaute Demütigungserfahrung aus der Schule, bei der man nicht verstand, warum das Hochkultur sein soll.
Und klar, es war einfach ein Knallersatz. Viele meinten, Mann wäre ein super Twitterer gewesen. Aber er hätte nie nur einen Satz geschrieben – das ist nicht die Logik der Tagebücher. Da gibt es keinen Eintrag mit nur einem Satz.
Wie ist denn die Idee zu „Thomas Manns Daily“ entstanden? Was war dein Ziel dabei?
Das war eher ein Impuls. Den ganzen Prozess kann ich gar nicht mehr rekonstruieren – das war einfach aus einer Laune heraus, weil ich nicht mehr allein mit der Tagebuchlektüre sein wollte. Ich hatte damals mit meinen Kolleg:innen an der Humboldt-Uni viel über die Tagebücher gesprochen und viel darin gelesen. Ich habe den Leuten immer erzählt, was für irrsinniges Zeug da drinsteht. Die Reaktionen waren immer schön – ich freu mich ja, wenn man Leute mit Literatur zum Lachen bringen kann. Nach zwei, drei Tweets hat das ganz gut funktioniert, und dann hab ich einfach weitergemacht.
Was ist da passiert?
Es gab einen lustigen Umgang damit von den Leuten, mit denen ich damals auf Twitter unterwegs war. Die Leute haben sofort kommentiert, dass es ihnen genauso geht. Diese sonderbare parasoziale Beziehung zum Account war von Anfang an da. Das hat Spaß gemacht und hat mich in meiner Lesart der Zitate bestärkt. Klar, unendlich viele Leute haben diese Tagebücher gelesen, aber anscheinend ist niemandem so richtig aufgefallen, dass da ziemlich sonderbares Zeug drinsteht – oder zumindest hat keiner gedacht, dass man das mal in den Fokus stellen könnte.
Die Zitate zeigen eine sehr menschliche, alltägliche Seite von Thomas Mann. Was macht den Reiz aus, die täglichen Herausforderungen und Unsicherheiten eines so hochgeschätzten Schriftstellers mitzuerleben?
Der Reiz besteht einerseits im Bruch mit dem gängigen Bild, dieser Vorstellung von Geistesgrößen und wie Literatur entsteht. Das ist auch eine Frage, die mich wissenschaftlich interessiert – wie der Prozess des Literaturproduzierens zu bestimmten Zeiten von den Schreibenden selbst kommentiert und verstanden wurde. Der andere Reiz ist einfach die Überraschung, dass man mit Thomas Mann etwas gemeinsam hat. Er wirkt ja oft unmenschlich und unnahbar. Es gibt so ein waberndes Bild von ihm in diesem Land. Ich glaube, bei vielen führt das zu einer Mischung aus Überraschung, Schadenfreude und einer sonderbaren Identifikation, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte.
Was war denn der Zweck der Tagebücher für Thomas Mann?
Er nannte sie „Tagesrechenschaften“ – ich glaube schon, dass das eine Art abendliches protestantisches Reinigungsritual war. Er hatte einen ziemlich komplexen Gefühlshaushalt, aber hatte später am Tag keine Lust mehr, das ausführlich aufzuschreiben. Die Logik war, wie Fritz Raddatz sagte: erst mein Werk, meine Ticks, dann die Welt. In den frühen Tagebüchern von 1918 bis '21 gibt es noch mehr Reflexionen über Politik, später wird es dann dieser Telegrammstil. Heinz Strunk hat das in seiner INTIMSCHATULLE [Anm. d. Red.: ein im Magazin TITANIC öffentlich geführtes Tagebuch] super nachgemacht – Sachen wie „Qualvolle Arbeit am Schreibtisch, zum Lunch gebratene Bücklinge.“ Das ist unheimlich witzig, weil Stichwortkomik, Thomas Mann hat das selbst gar nicht gesehen. Für ihn war es einfach ein Ritual, um den Tag abzuschließen und am nächsten Tag wieder seinen Zeitplan fahren zu können.
Über Felix Lindner
Felix Lindner (*1991) ist Literatur- und Kulturwissenschaftler sowie Lektor bei ZEIT ONLINE. Zuvor arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin und als freier Lektor und Korrektor für Verlage wie Ullstein, Hanser und Rowohlt. Bekannt wurde er durch den Twitter-Account „Thomas Mann Daily“ (2022–2023), auf dem er humorvolle Zitate aus den Tagebüchern des Schriftstellers veröffentlichte. Auf diesem Konzept basiert sein Buch MIT THOMAS MANN DURCH DAS JAHR (S. Fischer, 2024). In seiner Forschung beschäftigt sich Lindner mit Fragen der Körperlichkeit, Diätetik und dem Alltag literarischen Schreibens.
Bild: Mirko Lux

Wie hast du denn die Perlen gefunden?
Man muss die Tagebücher halt am Stück lesen. Vielleicht ist mir diese Seltsamkeit auch deshalb aufgefallen. In der Germanistik schaut man ja oft nur nach bestimmten Daten, mal hier rein, mal da rein. Aber um die Seltsamkeiten zu verstehen, muss man sie, glaube ich, komplett lesen.
Das war auch spannend, als sie nach und nach veröffentlicht wurden. Da gab es irgendwann viel Feuilleton drüber. Im Nachwort zum Buch habe ich versucht zu rekonstruieren, wie das Feuilleton die Veröffentlichung begleitet hat, von Ende der 70er bis '95. Darf ich kurz was dazu erzählen?
Klar!
Die ersten Auszüge aus den Tagebüchern 1933/34 kamen '77 raus – ausgerechnet in der Woche der Landshut- und Schleyer-Entführung. Im SPIEGEL, wo auf dem Cover „Atom“ und „Terror“ stand, waren irgendwo diese Auszüge versteckt. „Der Herausgeber hat es immerhin für nötig befunden, deren Veröffentlichung zu rechtfertigen“ heißt es dort über die Tagebücher – die Leute hatten echt andere Sorgen damals, es gab kein Gespräch daüber. Dann kamen alle zwei Jahre neue Bände, etwas änderte sich, und Reich-Ranicki sprach irgendwann von einer „Kultgemeinde“, die sich immer auf den nächsten Band freute.
Eine Tagebuch-Kultgemeinde?
Na ja, ich glaub nicht, dass es die in ernst zu nehmender Größe wirklich gab. Reich-Ranicki hat sich das wohl mehr oder weniger ausgedacht. Aber es gab wohl Interesse an dieser Art Intimjournal. ZEIT und SPIEGEL haben viel drüber geschrieben. '95 kam dann der letzte Band, der wurde groß im Literarischen Quartett besprochen. Sigrid Löffler meinte, „uns bleibt kein Abführmittel erspart“ – sie fand es grässlich. Reich-Ranicki druckste rum wegen der Relevanz: „Das war halt sein Leben: Fracktoilette und Champagner“. Er meinte dann noch „Aber es ist trotzdem ein unendlich wichtiges Stück des Werkes“ – er hat aber nicht erklärt, warum.
„Fracktoilette und Champagner“ treffen auf „Abführmittel“ – Am 14. Dezember 1995 nahm sich DAS LITERARISCHE QUARTETT Thomas Manns Tagebücher 1953–1955 vor.
Lass uns über dein Buch sprechen. Du versammelst darin wieder 365 Zitate. Was erwartet die Leser:innen, die Thomas Mann bisher nur als ernsten Literaturnobelpreisträger kennen?
Die Leser:innen erwartet ein Thomas Mann in einer anderen Lesart – eine, die ich mir eigentlich für viele Autoren wünsche. So eine graduelle Entsockelung der deutschen Geistesgrößen. In der WELT-Kommentarspalte wurde ich mal als Ikonoklast bezeichnet, was mir gut gefallen hat. So groß will ich es gar nicht machen, aber es ist ein anderer Zugang zur Hochkultur. Gerade bei Thomas Mann ist das Bild ja so festgefahren. Man nähert sich andächtig: Nicht husten vor dem Zauberberg!
Woher kommt dein Groll auf den Geniekult?
Der kommt aus verschiedenen Gründen. Ich habe mich ja viel damit beschäftigt, wie Männer Literatur produzieren. Mich nervt, dass Leute als Genies und Männer von eiserner Disziplin beschrieben werden, die von 9 bis 12 gearbeitet haben. Okay, es gab noch Repräsentation, Briefschreiberei und so. Aber zeig mir mal einen, der als Held der Arbeit bezeichnet wird und wirklich produktiv nur von 9 bis 12 arbeitet.
Sogar Mendelssohn, der die ersten Tagebücher herausgegeben hat, musste in seiner Biographie festhalten, dass die „Schreibtisch-Regelmäßigkeit“ weitgehend eine Legende war. Und diese Legende vom Schreibtischgenie wird in den letzten Jahren zunehmend zur Folie für moderne Arbeitskulturen. Mark Fisher hat ja schön beschrieben, wie der Neoliberalismus jede Historie so aussehen lässt wie seine eigene. Da wird dann gesagt „Schaut mal auf Thomas Mann, der hat auch so gearbeitet“. Aber das stimmt einfach nicht. Und was oft vergessen wird: Er war sehr reich, sehr früh, und musste nicht um sein Leben arbeiten. 1921 steht in den Tagebüchern „Meine Einnahmen dieses Jahr betragen 300.000 Mark“ – das war richtig viel Geld.
Über das Buch
MIT THOMAS MANN DURCH DAS JAHR (S. Fischer, 2024) zeichnet ein überraschend nahbares und oft amüsantes Porträt des Nobelpreisträgers. Während Thomas Mann als Inbegriff schriftstellerischer Disziplin gilt, erzählen seine Tagebücher eine andere Geschichte – eine von morgendlicher Trägheit, Magenproblemen und dem täglichen Ringen mit seinen selbst auferlegten Schreibquoten.
Herausgeber Felix Lindner, bekannt durch seinen Twitter-Account Thomas Mann Daily, hat 365 Tagebucheinträge zusammengestellt, die Manns Alltag in all seinen Krisen und Hindernissen zeigen. Trotz eines gut organisierten Haushalts, der ihn von äußeren Störungen abschirmte, war er kein unerschütterlicher „Zauberer“, der mühelos Prosa schuf – sondern oft müde, gereizt, voller Zweifel und abgelenkt vom Leben jenseits seiner Bücher.
Diese humorvolle und menschliche Sammlung, erschienen am 27. November 2024, bietet einen einzigartigen Einblick in das alltägliche Erleben eines der größten Schriftsteller der Literaturgeschichte.
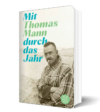
Neben einigen neuen Zitaten, was hat dich daran gereizt, das Projekt nun in Buchform zu gießen?
Mir war wichtig, dass ich selbst wieder neue Begeisterung für das Material entwickle, statt einfach nur Twitter-Beiträge zu kopieren. Deshalb habe ich das Ganze mit Anmerkungen angereichert – nicht streng wissenschaftlich, aber informativ: Wenn er zum Beispiel einen Mickey-Maus-Film, einen Detektivfilm oder "Das Geheimnis der Mumie" gesehen hat, habe ich recherchiert, um welche Filme es sich genau handelte. Insgesamt sind es ungefähr 50 solcher Anmerkungen geworden. Bei vielen Zitaten waren keine Erläuterungen nötig, sie sprechen für sich. Bei anderen fand ich es witzig, nachzuschauen: Was hat es mit dem Polofeld auf sich, dessen Lärm ihn so nervt? Wie hießen die Pudel über die Jahre? Und was ist Sedormid oder Benzedrin – also was er sich da alles reingehauen hat.
Und dann hast du noch ein Nachwort geschrieben.
Ja, ich habe mir vorgestellt, welche Fragen man hat, wenn man diese Zitate gelesen hat. Deswegen auch ein Nachwort und kein Vorwort – ich wollte die Leute nicht mit einer vorgefertigten Idee reinschicken. Mein Lektor Sascha Michel und ich fanden es schön, dass man erst das Material hat, ein bisschen verwirrt ist, und dann versucht wird, die Irritation einzufangen. Im Nachwort hab ich versucht, die Geschichte der Tagebücher und ihre Rezeption nachzuzeichnen. Die wichtigste Frage war für mich, warum sie diesen speziellen Sound haben, diesen Telegrammstil, woher die Schreibtischlegende kommt und wie das heute ahnungslos in Home-Office-Strategien oder Lebensratgeber übersetzt wird.
Was hast du gedacht, als ich dich gefragt habe, ob wir deine Tweets für eine Posterkampagne zum Thomas-Mann-Jubiläumsjahr verwenden können?
Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war: Es sollen wieder junge Leute angeworben werden. Ich weiß, es ist unendlich schwer, Manns Literatur für neue Lesergruppen interessant zu machen. Ich bin ein bisschen der Gewährsmann dafür, dass man versucht, aus dieser staubigen Ecke rauszukommen, in die sich die Germanistik und viele Thomas-Mann-Institutionen selbst reinmanövriert haben. Dann dachte ich mir: Das könnte gut auf Postern aussehen. Die Sätze haben so eine Eigentümlichkeit, wenn man sie einzeln nimmt – wie die Zitate auf den Bildschirmen in den Berliner U-Bahnen, wo die ewigen Weisheiten stehen. So ist das Buch ja auch ein bisschen gedacht.
Was erwartest du für eine Wirkung vom öffentlichen Aufhängen dieser Zitate?
Irritation. Irritation find ich gut. Die sorgt dafür, dass man einen anderen Blickwinkel bekommt. Die Leute werden ja so oft mit vermeintlich guten Zitaten zugepflastert. Das ist ja eine richtige Industrie geworden.
Mit Erbaulichem ...
Ja, Nachdenkliches, Erbauliches. Da wird immer sehr betulich mit Leuten umgegangen. Das führt dazu, dass viele denken, die würden aus Kaffeepulver Genialität pressen und es käme nur Aphoristisches dabei raus. Mir ist dann aufgefallen, dass dieser Telegrammstil auch was witzig Aphoristisches hat und genau diese Länge, die solche Zitate haben. Ich erwarte mir Irritation und Freude. Mehr kann man erstmal gar nicht erwarten. Ich würde mich freuen über eine andere Art von Auseinandersetzung im nächsten Jahr. Eine, die ihre Kanonisierung auch mal infrage stellt.
Über die Posterkampagne
Ein Highlight des Jubiläumsjahres ist die Mann-2025-Plakatkampagne, initiiert von Thomas Mann International in Zusammenarbeit mit Felix Lindners gefeiertem Twitter-Projekt @DailyMann, dem S. Fischer Verlag und dem Berliner Designstudio Studio Yukiko.
Aufbauend auf dem Erfolg von @DailyMann, das von April 2022 bis April 2023 mit täglichen Tagebuchauszügen zehntausende Follower begeisterte, bringt die Kampagne Manns humorvolle und eigenwillige Beobachtungen einem breiteren Publikum näher und bietet eine frische Perspektive auf den Schriftsteller.

Über den Autor
Mirko Lux ist Koordinator und Redakteur von MANN 2025: 150 JAHRE THOMAS MANN. Er studierte Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Berlin und Siena. Nach mehreren Jahren als freiberuflicher Journalist und Fotograf ist er seit Mai 2013 als Referent für Programme und Kommunikation im Berliner Büro von Villa Aurora & Thomas Mann Haus tätig.
Bild: © Tobias Kruse/OSTKREUZ

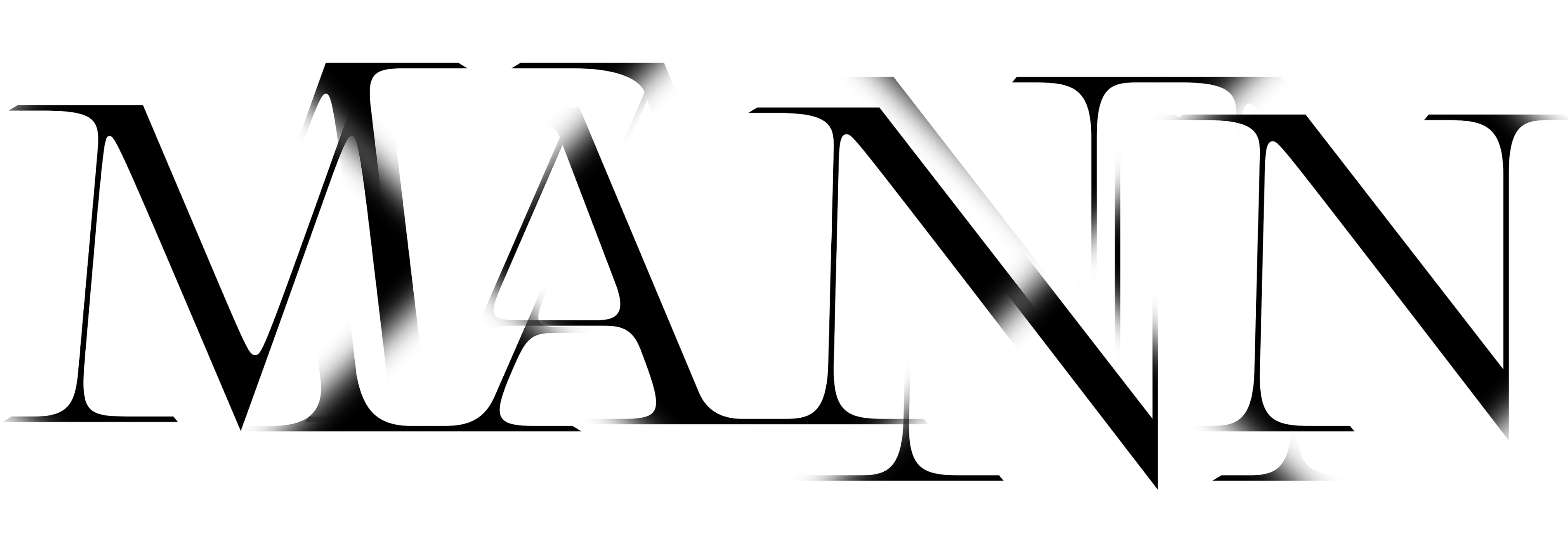


![„Selbstverständlich fielen meine Augen auf einen Adonis in der Badehose […].“ (aus Thomas Manns Tagebüchern, 27. August 1950)
"Naturally, my eyes fell on an Adonis in swim trunks […]." (from Thomas Mann’s diaries, August 27, 1950)](https://mann2025.de/wp-content/uploads/2025/03/thomasmann-postercampaign-11-100x142.png)