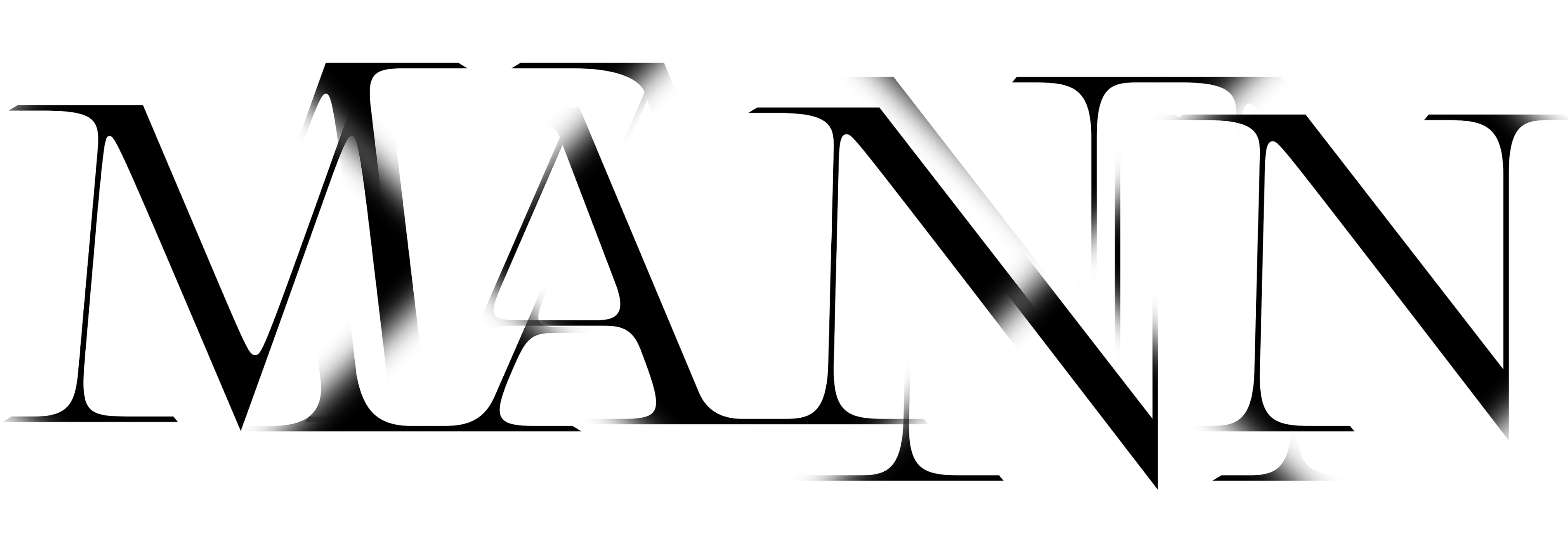Er hat es selbst sein wildestes Buch genannt und die Überraschung kundgetan, wie einer denn in seinem Alter sein wildestes Buch schreiben könne, immerhin näherte er sich seinem neunundsechzigsten Jahr, als er damit begann. Das Prädikat könnte in mehrfacher Hinsicht zutreffen. Einerseits ist ein Buch, in dem der Teufel auftritt, per se ein wildes Buch, und vielleicht sogar noch mehr, wenn sich ein Gespräch mit dem Teufel am Ende als Selbstgespräch herausstellt, mit dem allerdings wahrhaftigen Teufelspakt und Verdikt gegen die eigene Person, keinen Menschen zu lieben. Andererseits ist es ein wildes Buch, weil es vor dem Hintergrund von wilden Zeiten eine wilde Geschichte erzählt und dabei Ausblicke auf die schreckliche Realität in den Jahren seines Enstehens gibt mit der immer deutlicher sich abzeichnenden deutschen Niederlage im Krieg und den damit nur weiter einhergehenden Verheerungen und letzten sinnlosen Schlägen gegen alle Menschlichkeit. Ein wildes Buch ist es auch »als autobiographische Dichtung, als religiös tief aufgewühltes Bekenntniswerk, das mich beinahe das Leben gekostet hätte«, wie der Autor es selbst einschätzt, also als Selbstbefragung eines Künstlers, der abwägt, wieviel Kälte es braucht, um die für das Werk notwendige Hitze zu erzeugen. Aber für Thomas Mann muss der Doktor Faustus natürlich und wohl auch vor allem deshalb ein wildes Buch gewesen sein, weil dem hoch reflektierten Romancier in vorgerücktem Alter Möglichkeiten des Romans bewusst werden, die einmal mehr die Form erweitern und außerhalb des eigentlichen Kerngebiets des Genres zu liegen scheinen, irgendwo in dem nie wirklich genau definierten Grenz- und Überschneidungs- und Überlagerungsgebiet von Fakten und Fiktionen, das uns Heutigen so selbstverständlich erscheint und das einem der großen Meister der Romankunst des zwanzigsten Jahrhunderts immer wieder überraschende Erkenntnisse abnötigt, geradeso, als hätte er nicht selbst lange schon zwischen den Fronten gewildert.
Es ist faszinierend nachzulesen, wie sich der Autor nach Abschluss des letzten Bandes der Joseph-Tetralogie umgehend dranmacht, sich für einen neuen Roman in Stellung zu bringen oder warmzulaufen, wenn man so will, beginnend mit dem Freiräumen seines Schreibtisches und dem Leeren der Schubladen, beginnend mit der nur scheinbar zufälligen Lektüre, die schnell als nicht zufällig, sondern als zielgerichtet erkannt wird, sobald nur einmal das Ziel festgestellt ist. Es gibt da diesen Fauststoff, in dem er schon vor zweiundvierzig Jahren ein mögliches Arbeitsvorhaben gesehen hat, mit dem merkwürdigen Wissen oder Vorsatz des damals noch jungen Schriftstellers am Anfang seiner Karriere, das Faust-Buch sollte sein letztes Buch werden. Also doch besser alles aufschieben und sich anderem zuwenden, Mangel an Ideen herrscht nicht, oder das Risiko eingehen und das Schicksal herausfordern? Schließlich will niemand jemals sein letztes Buch schreiben, sondern immer nur das nächste, mit dem er den Tod vielleicht noch einmal besiegt. Fast könnte man meinen, dass Thomas Mann beim Schreiben des Doktor Faustus selbst einen Teufelspakt eingegangen ist, und Gelingen oder Misslingen hätte entschieden, ob ihm danach noch ein Roman vergönnt wäre, aber da ist er ohnehin schon mittendrin, alles ist längst auf das eine ausgerichtet, alles Leben, alles Lesen fällt in den gleichen riesigen Trichter, der in Ansatz gebracht wird, und es gibt kein Zurück mehr, die Sache muss »vorwärtsgetrieben« oder »gefördert« werden, um es in seinen Worten zu sagen.
Am 23. Mai 1943 schreibt der deutsche Schriftsteller Thomas Mann, noch tschechischer, bald aber schon amerikanischer Staatsbürger, in seinem Haus in Pacific Palisades, Kalifornien, die ersten Zeilen seines Romans Doktor Faustus, »Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde«, wie es im Untertitel heißt, und an ebendiesem Tag setzt sich (in der Wirklichkeit des Romans) ebendieser Freund, Serenus Zeitblom mit Namen, in seinem Studierzimmer in Freising an der Isar hin und beginnt zu erzählen. Damit ist der wesentliche Knoten geschürzt, ebenso naheliegend wie genial, und damit ist die Maschine in Gang gesetzt, in der sich Fakten und Fiktionen aneinander entzünden können. Der schon über zehn Jahre im Exil lebende Autor wählt als Erzähler einen etwas behäbigen, altmodischen Gelehrten, der im inneren Exil lebt und von Anfang an zu fürchten hat, die falschen Leute könnten sein Manuskript in die Hände bekommen, was mit seinen Söhnen beginnt, die beide »ihrem Führer dienen«, wie es heißt, und damit endet, dass Serenus Zeitblom darüber nachdenkt, sein Buch zuerst in Amerika erscheinen zu lassen, in englischer Übersetzung. Es ist also von vornherein ein Buch, das manche, vielleicht viele, so nicht haben wollen, nicht die schlechteste Voraussetzung für einen Schreibenden, und das in eine Welt fallen soll, deren Kultur sich selbst so zugrunde gerichtet hat, dass es noch gar kein Umfeld und keine Möglichkeiten für solche Bücher gibt. Wo Serenus Zeitbloms Biografie von Adrian Leverkühn erscheinen wird, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass der Doktor Faustus von Thomas Mann 1947 im Bermann-Fischer Verlag mit der Verlagsadresse Stockholm erschienen ist, und auch das gehört zur Geschichte dieses Romans und zur Geschichte Deutschlands.
Was hat es im Formalen nun auf sich mit der Behauptung Thomas Manns, das sei sein wildestes Buch? Man kann im Roman den poetoloischen Äußerungen Serenus Zeitbloms nachgehen, die es da und dort gibt und die dem Gelehrten, der sich mit der avanciertesten Musiktheorie auseinandersetzt, eher konventionelle Vorstellungen von den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Erzählens bescheinigen. Er beginnt auch sehr konventionell, indem er sich über die Vorfahren seines Helden ausbreitet, und schreitet dann in klassisch getragener Biografenmanier linear in der Zeit fort, fällt sich mehrfach selbst ins Wort und entschuldigt sich beim Leser, wenn er die Linearität einmal durchbricht und auf spätere Ereignisse vorgreift. Wiederholt beanstandet er Längen und rechtfertigt sich gleichzeitig für diese Längen, wenn er seinem Gegenstand gerecht werden wolle, macht einmal sogar den Teufel dafür verantwortlich und könnte sie doch seinem Schöpfer anlasten, wenn er nur Kenntnis von ihm hätte, und mehrfach betont er, was er schreibe, sei kein Roman, und seufzt dann doch wieder, man müsste ein Romanschriftsteller sein. Er konstatiert, »dass ich diese Quisquilien und Krümel-Abfälle meiner Beobachtung hier garnicht hätte aufnehmen dürfen«, weil sie nicht »buchgerecht« sind, und klagt dann über »die Begierde, alles auf einmal zu sagen«, die seine Sätze »überfluten« und ihn »schlecht« schreiben lässt. Er stellt die richtigen Fragen, wenn er sich vor seinen Lesern rechtfertigt, woher er alles wisse, wenn er manchmal gar nicht dabeigewesen sei, neigt aber bei den Antworten dazu, viel weniger klar zu sein, geht einmal sogar so weit zu behaupten, er sei in einer Szene »dabeigewesen«, obwohl er gar nicht dabei war, könnte das jedenfalls glaubhaft machen und das in der Szene Gesprochene wiedergeben, obwohl er es nicht gehört hatte - wenn, ja, nur wenn, und das ist das Konventionelle seiner Haltung, er kein Biograf, sondern ein allwissender Romanschriftsteller wäre. Denn damit überschätzt er und unterschätzt er gleichzeitig die Möglichkeiten des Romans, der sich einer anderen Wahrhaftigkeit verpflichtet weiß.
Es ist nun das eine, wenn Serenus Zeitblom, der eine Biografie schreibt, sich mehrfach gegen die Fallen der Geschwätzigkeit und des falsch Romanhaften absichert, indem er sagt, er schreibe keinen Roman, es ist etwas ganz anderes, wenn Thomas Mannn, der natürlich einen Roman schreibt, was sonst soll es sein, von sich behauptet, er schreibe eine »Biographie mit allen Charakteristiken einer solchen«, wenn auch eine fingierte Biografie. Dabei spricht er von »Wirklichkeit, die sich in Fiktion verwandelt, Fiktion, die das Wirkliche absorbiert, eine eigentümlich träumerische und reizvolle Vermischung der Sphären«, stellt »eine unbedenkliche Bereitschaft zur Aneignung dessen, was ich als mein eigen empfinde« fest, will sagen »was zu mir, das heißt zur ›Sache‹ gehört«, und bescheinigt sich dann doch wieder Verdutzheit, »Verdutztheit durch das Unromanhafte, sonderbar real Biographische, das doch Fiktion ist ...« Dabei wäre längst schon eher Verdutztheit angebracht über die Erwartung an das Romanhafte eines Romans, weil da bereits eine Entwicklung ihren Anfang genommen hat, die damit endet, dass das Urteil, ein Roman sei romanhaft, etwas vom Vernichtendsten ist, das man über ihn sagen kann.
Der Autor ist auf jeden Fall schon viel weiter als sein Erzähler, wenn auch vielleicht noch nicht so weit wie der Teufel in dem Roman, der aller Fiktion eine Absage erteilt, »[z]ulässig« sei »allein noch der nicht fiktive, der nicht verspielte, der unverstellte und unverklärte Ausdruck des Leides in seinem realen Augenblick«, und Thomas Mann ist mitten im Schreiben seines Doktor Faustus, als ihm bei der Lektüre des James-Joyce-Buches von Harry Levin die halb geöffneten Augen ganz aufzugehen scheinen. Zuerst beschäftigt ihn die Sorge, »daß neben Joyces exzentrischem Avantgardismus mein Werk wie flauer Traditionalismus wirken müsse«, doch dann gibt er der Überzeugung Ausdruck, dass sie sich in der Haltung, eine bestimmte Art von Realismus hinter sich zu lassen, näher sind, als es den Anschein haben mag. Wenn die Romane von Joyce keine eigentlichen Romane sind oder »novel[s] to end all novels«, wie er aus dem Buch zitiert, dann trifft das seiner Meinung nach »wohl auf den Zauberberg, den Joseph und Doktor Faustus nicht weniger zu«. Das verbindet er mit der Frage, aber eigentlich ist es schon ein Schluss, »ob es nicht aussähe, als käme auf dem Gebiet des Romans heute nur noch das in Betracht, was kein Roman mehr sei«, und lässt dann noch einmal Harry Levin zu Wort kommen: »The best writing of our contemporaries is not an act of creation, but an act of evocation, peculiarly saturated with reminiscences.« Daran hat sich bis heute nicht viel oder eigentlich gar nichts geändert.
Sein wildestes Buch? Vielleicht! Auf jeden Fall ein Wahnsinnsding mit sichtbaren Schwächen in seinem Mäandern, aber mit noch viel deutlicher sichtbaren Stärken im Versuch, Erzählkonventionen hinter sich zu lassen und ans Äußerste zu gehen, »[the] utmost«, wie er es von aller Kunst verlangt. Seine Tochter Erika, die ihn während des Entstehens immer wieder zu Kürzungen gedrängt hat, telegrafiert ihm, einem Zauberer angemessen, nach der Lektüre des Manuskripts: »Read all night. Shall go into newyear reddened eyes but happy heart. Wondering only how on earth you do it. Thanks, congratulations, etc.«, wunderbares Englisch in anhaltender deutscher Nacht unmittelbar nach dem Krieg. Das alles kann man in Die Entstehung des Doktor Faustus von Thomas Mann lesen, und darin findet sich auch, was Charlie Chaplin zu dem Autor auf einer Party angeblich sagte, nachdem der ihm von seinem Roman erzählt hatte: »›That's fascinating!‹ sagte er. ›That may happen to be your greatest book.‹«, ohne eine Zeile zu kennen, und man könnte natürlich widersprechen, muss aber nicht.
Über den Autor
Norbert Gstrein, geboren 1961 in Mils in Tirol, studierte Mathematik in Innsbruck und besuchte dann sprachphilosophische Seminare in Stanford und Erlangen. Gstrein erhielt unter anderem den Alfred-Döblin-Preis, den Uwe-Johnson-Preis sowie den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung.