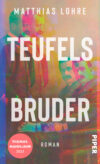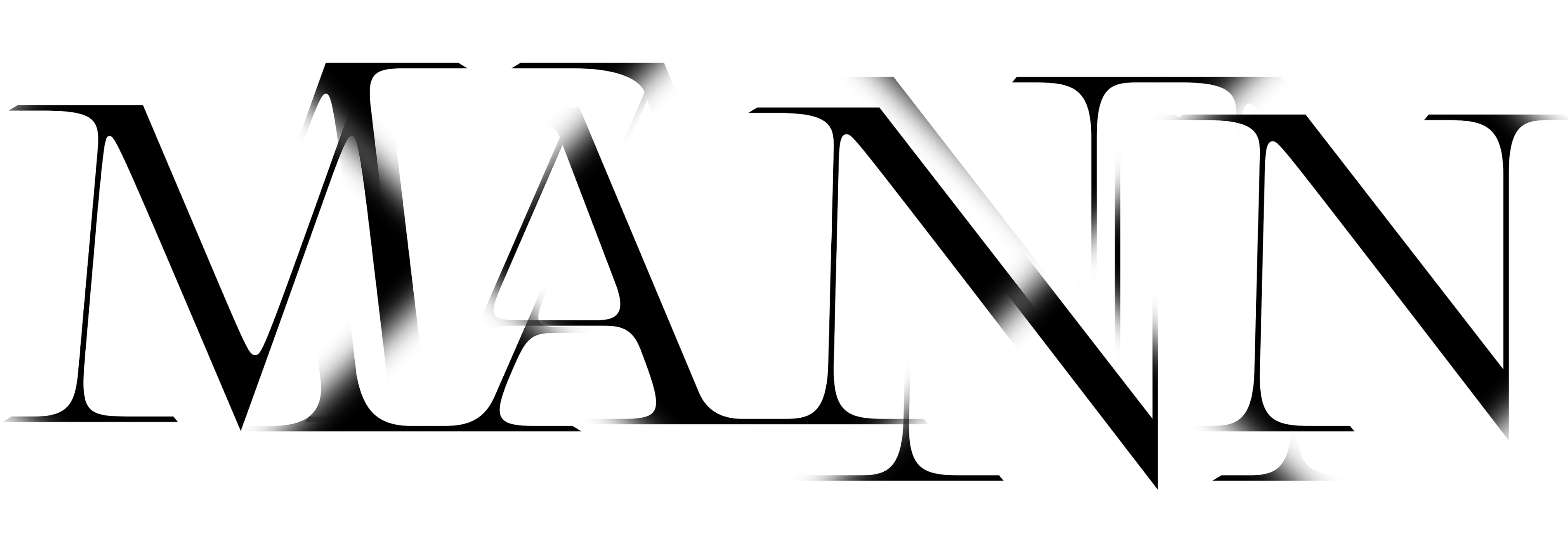Thomas Mann ist 21 Jahre alt, ein zielloser Volontariatsabbrecher ohne Abitur, als er dem bewunderten älteren Bruder Heinrich nach Italien folgt. Außer wenigen kurzen Erzählungen, die kaum jemand beachtet, hat er nichts vorzuweisen. Anderthalb Jahre später kehrt er wie verwandelt nach München zurück: Bei sich trägt er das dicke, immer weiter anwachsende Manuskript seines tausendseitigen Debütromans. BUDDENBROOKS wird Mann den Nobelpreis einbringen.
Was hat dazu geführt?
Zwischen Sehnsucht und Selbstverleugnung
Die Frage fasziniert mich, seit ich begann, mich für den Menschen Thomas Mann zu interessieren. Mir kam es vor, als lebten da zwei Seelen in seiner Brust: Einerseits war Mann außerordentlich feinfühlig und anlehnungsbedürftig. Kaum jemand hat seelische Qualen so anschaulich und mitfühlender geschildert als er. Andererseits konnte er eiskalt sein, sogar gegenüber den Menschen, die ihm am nächsten standen.
Überhaupt, die Liebe: Er suchte und fand Halt bei Katia, mit der ein halbes Jahrhundert lang verheiratet war, und mit der er sechs Kinder zeugte. Doch romantische Verschmelzungssehnsüchte verspürte er allein in Bezug auf junge Männer, die er aus der Ferne anhimmelte. Er sehnte sich nach der Grenzüberschreitung – und fürchtete nichts mehr als sie.
Das trug auch bei zur Rivalität mit Heinrich, dem vier Jahre Älteren, der seine Sexualität mit Frauen offen auslebte – und auch noch darüber schrieb. Unter seinen Hemmungen, Sehnsüchten und Ängsten hat Thomas Mann schrecklich gelitten – und sie für sein Werk fruchtbar gemacht. Aber wie gelang es ihm, all das Widerstreitende zu bändigen?
Rückkehr des Verdrängten
Mein Roman beginnt mit einer Szene im Jahr 1953. Der 77-jährige Thomas Mann reist ein letztes Mal nach Italien. Was er da bekennt, scheint einem seiner Romane zu entstammen. Und doch deutet alles darauf hin, dass es sich so zugetragen hat.
Mann gewährt einem in Rom lebenden Maler, dem aus München stammenden Fabius von Gugel, einen Besuch in seinem Apartment im Luxushotel Excelsior. Interessiert betrachtet er dessen mitgebrachte Zeichnungen: einen ganzen Zyklus von Illustrationen zum Aschenputtel-Märchen der Brüder Grimm. Groteske, traumhafte Bilder, versehen mit ähnlich rätselhaften Kommentaren. Thomas Mann lässt sich Zeit, wirkt auf seinen Gast nachdenklich. Der Biograf Peter de Mendelssohn wird Gugels Augenzeugenbericht später so wiedergeben:
Er müsse ihm sagen, meinte Thomas Mann schließlich, dass die Zeichnungen ihn sehr stark an ein eigenes Erlebnis erinnerten, an eine Vision, die er als junger Mensch einmal gehabt habe. Eine Vision?, fragt der Maler. Allerdings eine Vision. Gugel war sich sicher, dass Thomas Mann mit Nachdruck dieses Wort gebrauchte, nicht Halluzination, Traumgesicht, Phantasiegespinst, Einbildung oder dergleichen, sondern ausdrücklich: Vision. Es sei in seinen jungen Jahren gewesen, als er mit seinem Bruder die Sommerwochen in Palestrina verbrachte, und dort habe er im steinernen Saal in der Nachmittagshitze urplötzlich, auf dem schwarzen Sofa sitzend, einen Fremdling erblickt, von dem er gewusst habe, dass er kein anderer als der Teufel gewesen sei.
Geist im Manuskript
Später habe Gugel die Formulierung, wie Thomas Mann sie ihm gab, „nahezu wörtlich“ im Roman DOKTOR FAUSTUS gefunden. Darin erinnert der Teufel den Komponisten Adrian Leverkühn daran, dass sie beide im Bunde seien: Leverkühn darf geniale Werke erschaffen und muss dafür mit seiner Seele bezahlen. Und: Niemanden darf er lieben. Das berühmt gewordene Teufels-Kapitel spielt in eben jener Herberge in Palestrina, in der Thomas mit seinem Bruder einst gewohnt hatte.
Hat Mann das tatsächlich gesagt? Ausgerechnet der sonst so kühle, ja kalt auftretende Meister der Selbsttarnung? Peter de Mendelssohn kannte Thomas Mann und Fabius von Gugel persönlich – und hielt die Geschichte für glaubwürdig: „Kein Zweifel, dass dass Erlebnis authentisch ist.“ Es „fand statt, im Spätsommer 1897, im Steinsaal zu Palestrina“.
Je mehr ich von und über Thomas Mann gelesen habe, desto schlüssiger erscheint diese seltsame Begebenheit auch mir. Denn Thomas Mann hat immer wieder bekannt, er erfinde seine Geschichten nicht, sondern finde sie. Nahezu alles in seinen Werken gründet in selbst Erlebtem: im Erstlingsroman über eine norddeutsche Kaufmannssippe natürlich, aber auch im TOD IN VENEDIG. Der Novelle ging ein Besuch der Lagunenstadt voraus.
Sein Leben lang hat Mann es verstanden, sogar Nebensächlichem vielfach schillernde Bedeutungen zu verleihen. Als seine Frau Katia sich 1912 in einem Lungensanatorium in Davos in den Schweizer Alpen erholte, besuchte er sie für drei Wochen. Die literarische Frucht war DER ZAUBERBERG. Übrigens spielt auch darin der Teufel eine deutlich größere Rolle, als man lange meinte. Das hat der Autor und Literaturkritiker Michael Maar eindrucksvoll herausgearbeitet in seiner unter dem Titel GEISTER UND KUNST veröffentlichten Dissertation. Später nahm Maar sich in DAS BLAUBARTZIMMER der verstreuten Teufels-Spuren in Manns Werk an. Und davon gibt es erstaunlich viele.
So taucht die Vision, die im DOKTOR FAUSTUS ein langes Kapitel einnimmt, schon ein halbes Jahrhundert zuvor, in aller Kürze, in den BUDDENBROOKS auf. Da fragt Christian seinen Bruder, den Konsul, ob der das auch kenne: „wenn du in der Dämmerung in dein Zimmer kommst, du auf einem Sofa einen Mann sitzen siehst, der dir zunickt und dabei überhaupt gar nicht vorhanden ist?!…“. Als Thomas Mann das schrieb, war er noch in Italien oder gerade erst zurückgekehrt. Von teuflischen Gestalten – häufig nachlässig gekleideten Herren mit rotem Haar – schrieb er fortan immer wieder, so auch im TOD IN VENEDIG.
Vom heißen Sommer zur literarischen Unsterblichkeit
Ich bin überzeugt: In Italien, im Sommer 1897, ist der halt- und richtungslose „Tommy“ über die Frage, wie er persönliche Sehnsüchte, Ehrgeiz und gesellschaftliche Zwänge überein bringen soll, in eine tiefe Krise gestürzt. In Palestrina widerfuhr ihm etwas, das ihn zutiefst veränderte. Damals reifte in ihm die Idee, die Geschichte seiner Familie zum Roman zu formen. Damit fand er seine Bestimmung, seinen Stil und seine Dichter-Persona. Sie wurde ihm zur Maske, zum Schutzschild und zur Projektionsfläche zugleich. BUDDENBROOKS haben ihm nicht nur Weltruhm verschafft. Sie haben ihm – vielleicht – das Leben gerettet.
Über den Autor
Matthias Lohre (*1976) ist Schriftsteller, Journalist und Sachbuchautor aus Berlin. Nach einem Studium der Geschichte und Anglistik sowie einer journalistischen Ausbildung arbeitete er neun Jahre als Redakteur bei der tageszeitung und schrieb später u.a. für Geo Epoche, P.M. History und Zeit Geschichte. Bekannt wurde er durch seine Sachbücher wie DAS ERBE DER KRIEGSENKEL (2016) und DAS OPFER IST DER NEUE HELD (2019), die sich mit gesellschaftlichen und psychologischen Themen befassen. Sein Debütroman DER KÜHNSTE PLAN SEIT MENSCHENGEDENKEN (2021) erzählt die Geschichte des Atlantropa-Projekts, während sein zweiter Roman TEUFELS BRUDER (2025) die Italienreise von Heinrich und Thomas Mann fiktionalisiert. Lohre ist Mitgründer des PEN Berlin.
Bild: © Denise Sterr

Über das Buch
Matthias Lohres Roman TEUFELS BRUDER erzählt eindrucksvoll von einer prägenden Italienreise der Brüder Heinrich und Thomas Mann in den Jahren 1896 bis 1898. Während Heinrich bereits erste literarische Erfolge vorweisen kann, ringt der 21-jährige Thomas noch um seine künstlerische Identität. Überschattet vom frühen Tod des Vaters und anhaltenden finanziellen Sorgen, entwickelt sich zwischen den Brüdern ein intensiver Wettstreit – ein Spiegel ihrer Rivalität und gegensätzlichen Lebensentwürfe.
Im Mittelpunkt steht Thomas’ Begegnung mit einem melancholischen Jüngling in Venedig, eine Erfahrung, die ihn zutiefst erschüttert und zunehmend in ihren Bann zieht. Aus dieser Begegnung erwächst eine Obsession, die zum Ausgangspunkt einer inneren wie äußeren Reise wird und schließlich in einer verstörenden Vision gipfelt.
Mit erzählerischer Eleganz und feinem Gespür für historische Atmosphäre entwirft Lohre das Porträt eines jungen Thomas Mann – sensibel, von Selbstzweifeln gezeichnet und auf der Suche nach sich selbst. Auf dieser Reise legt er die Grundlage für sein späteres literarisches Schaffen. | Weitere Informationen