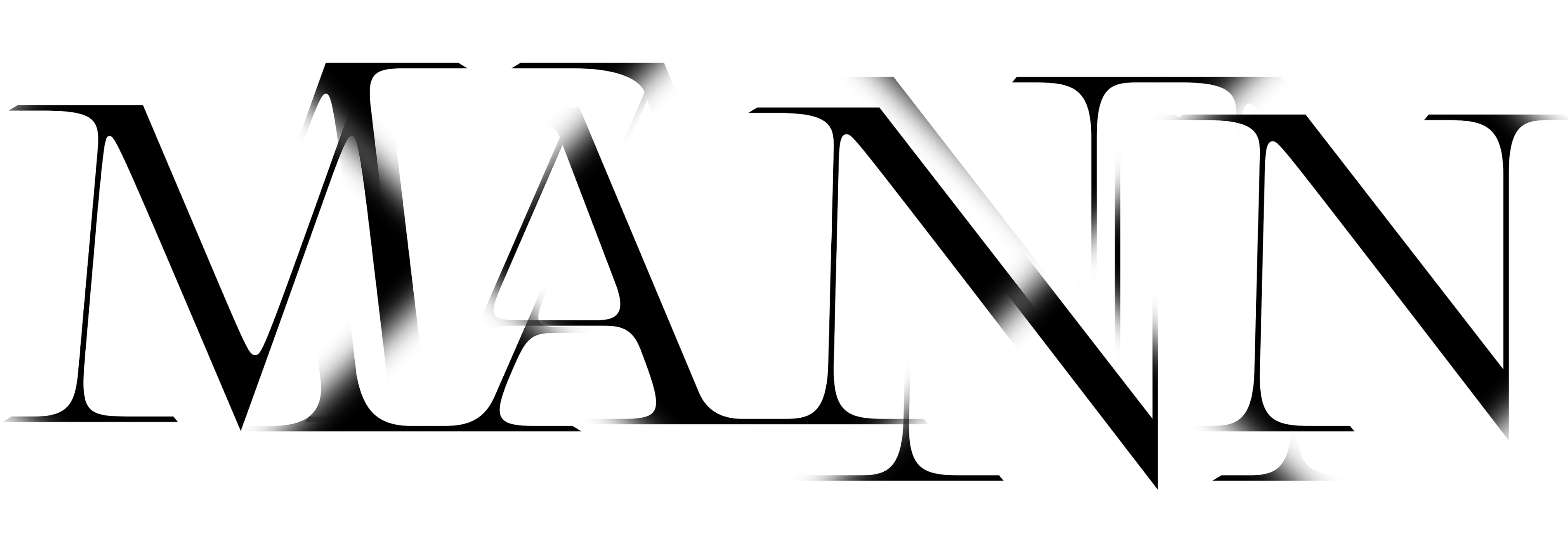Wann erreicht eine Demokratie ihren Kipppunkt? Wann genügen Argumente im öffentlichen Meinungsstreit nicht mehr, und wann wird Widerstand zur Pflicht? Diese Fragen stellte sich Thomas Mann im Herbst 1930. Für seine DEUTSCHE ANSPRACHE, APPELL AN DIE VERNUNFT im Untertitel, kehrte er in den Berliner Beethovensaal zurück – ausgerechnet in jenen Saal, in dem er sich acht Jahre zuvor mit der Rede VON DEUTSCHER REPUBLIK entschieden für die Demokratie ausgesprochen hatte.
Vorausgegangen war ein gewaltiger, sprunghafter Stimmenzuwachs der NSDAP bei der Reichstagswahl vom 14. September 1930. Fast ein Fünftel der Wählerinnen und Wähler hatten sich für Adolf Hitler und seine Partei ausgesprochen. Noch zwei Jahre zuvor hatten sie nur 2,6 Prozent erreicht.
Für Thomas Mann bedeutete dieses Ergebnis eine Zäsur, nicht nur für das Land, sondern auch für sein eigenes politisches Denken und Handeln. 18,3 Prozent: Es ist diese Zahl, die aus dem engagierten Republikaner und Demokraten Thomas Mann einen bekennenden Aktivisten und Antifaschisten machte.
Von unmittelbaren Notgedanken
Seine Ansprache hebt mit einem scheinbar eindeutigen Dementi an: „Ich bin kein Anhänger des unerbittlich sozialen Aktivismus“, erklärte er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern da. Das Zeitalter des ästhetischen Idealismus sei unwiederbringlich vorüber, aber das bedeute nicht, dass man einer „aktivistischen Gleichung von Idealismus und Frivolität“ zustimmen müsse. Die Abwehr ist eine rhetorische Geste, die keine andere Funktion hat, als die Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz als ausweglos erscheinen zu lassen:
Dennoch gibt es Stunden, Augenblicke des Gemeinschaftslebens, wo solche Rechtfertigung der Kunst praktisch versagt; wo der Künstler von innen her nicht weiterkann, weil unmittelbare Notgedanken des Lebens den Kunstgedanken zurückdrängen, krisenhafte Bedrängnis der Allgemeinheit auch ihn auf eine Weise erschüttert, daß die spielend leidenschaftliche Vertiefung ins Ewig-Menschliche, die man Kunst nennt, wirklich das zeitliche Gepräge des Luxuriösen und Müßigen gewinnt und zur seelischen Unmöglichkeit wird.
„Unmittelbare Notgedanken“, „krisenhafte Bedrängnis“: Im eloquenten Flow der Wörter und Sätze geht die Drastik, mit der Thomas Mann die damalige gesellschaftliche Lage beschreibt, fast ein wenig unter. Dabei wird erst vor ihrem Hintergrund die geradezu lutherische Haltung, die sich mit seinem Bekenntnis verbindet, in ihrem ganzen Pathos erkennbar: Er kann nicht anders. Das Grundanliegen seiner Rede war es, das Emporkommen des Nationalsozialismus zu erklären und die Bewegung im selben Atemzug auf rhetorische Weise zu desavouieren.
Schnell, hart, punktgenau
„Rein wirtschaftlich“, so beginnt Thomas Mann seine Auseinandersetzung mit dem Nazitum, lasse sich das Phänomen nicht verstehen, nicht bloß als ein Resultat von Arbeitslosigkeit, Hunger und Kälte, die das gesellschaftliche Leben infolge der Weltwirtschaftskrise prägten. Das wäre zu einfach.
Vielmehr vermischten sich in ihm zwei Tendenzen: Zum einen ein „aus akademisch-professoraler Sphäre“ stammendes pseudo-intellektuelles Programm aus „mystischem Biedersinn und verstiegener Abgeschmacktheit“, das mit „Vokabeln wie rassisch, völkisch, bündisch, heldisch“ den „Deutschen von 1930“ die Gehirne „verschwemmt und verklebt“ habe. Zum andern eine „Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv-massendemokratischer Jahrmarktsroheit“, die die gesellschaftliche Welt erfasst habe, eine Welt des Konsums, der Nervosität, der Technik, des Lärms, kurzum: der entfesselten Moderne. Aus dieser unheilvollen Verbindung sei ein ins Groteske und Orgiastische verzerrter Politikstil entstanden: „Fanatismus wird Heilsprinzip, Begeisterung epileptische Ekstase […], und die Vernunft verhüllt ihr Antlitz“.
Der Aktivismus der Ansprache zeigt sich nicht nur in Manns explizitem Bekenntnis dazu, sondern vor allem in seiner Sprache. In einem verdichteten, rasanten Nominalstil reiht Thomas Mann bildgewaltige Zuschreibungen aneinander, um seinen Gegenstand regelrecht niederzuprügeln: „Fanatismus“, „Heilsprinzip“, „Ekstase“ und so weiter. Es ist unverkennbar Rhetorik des Angriffs, des clean hit – schnell, hart, punktgenau.
Feinde in Smokings
Was gut ist und was böse – in der DEUTSCHEN ANSPRACHE wird diese unzweideutige Unterscheidung nicht zuletzt auf rhetorisch-performative Weise getroffen. Und darin liegt wohl auch der markanteste Unterschied zu der acht Jahre zuvor gehaltenen Republikrede, auf die Thomas Mann durch die Wahl desselben Vortragsorts unter der Hand Bezug nimmt. Wollte der Redner dort seine Zuhörer für seine Position ausdrücklich „gewinnen“, mit ihnen also in einen demokratischen Streit um das bessere Argument eintreten, hat er es nun mit einem politisch-gesellschaftlichen Phänomen zu tun, das sich unter demokratischen Gesichtspunkten schlechterdings nicht debattieren lässt. Keine Gegner im politischen Meinungskampf stehen ihm im Jahr 1930 gegenüber. Es sind Feinde.
Und sie sind es an jenem Berliner Oktoberabend nicht bloß im übertragenen Sinne. Unter die bürgerliche Zuhörerschaft hatte sich auch eine Gruppe von Störern gemischt, darunter die Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger. Hinzu kamen weitere zwanzig Männer der SA, verkleidet in geliehenen Smokings, die Joseph Goebbels persönlich in den Saal beordert hatte. Aus anfänglichen Zwischenrufen wurde bald ein allgemeiner Tumult, der schließlich sogar einen Polizeieinsatz erforderlich machte. Die Szene ist auf einer berühmten Fotografie dokumentiert. Während sich das Publikum umwendet, fragend, was in den hinteren Reihen vor sich geht, steht Thomas Mann mit versteinertem Blick am Rednerpult. Es muss unheimlich gewesen sein, dass sich in diesem Moment genau das verwirklichte, wovor er in seiner Rede warnte: die gewaltsame Verunmöglichung eines demokratischen Meinungsstreits.
Weil es nichts anderes bedeutet hätte, als sich geschlagen zu geben, als Redner und als Demokrat, ließ sich Thomas Mann auf den ihm zugerufenen Vorschlag, die Ansprache abzubrechen, nicht ein. Besorgt um seine körperliche Unversehrtheit war er aber offenbar schon: Rasch nachdem der letzte Satz gesprochen war, eilte er aus dem Saal, um sich in Sicherheit bringen zu lassen.
Fake News gegen den Widersacher
Die besagte Fotografie des Abends wurde von der Nazi-Presse gezielt für die Verbreitung von Fake News instrumentalisiert. Es wurde behauptet, das Publikum habe sich demonstrativ vom Redner abgewandt, niemand habe Thomas Manns APPELL AN DIE VERNUNFT hören wollen, er stehe mit seinen politischen Ansichten auf weiter Flur allein da.
Tatsächlich war das Gegenteil der Fall, die Zuhörerschaft hatte durch ihren anhaltenden Beifall mit dazu beigetragen, die Sprengung der Veranstaltung zu verhindern. Die Lüge der Nazipropaganda verfolgte kein anderes Ziel, als das reale Scheitern ihrer Aktion in einen medialen Sieg umzuwandeln.
Die Rede im Beethovensaal bedeutet für Thomas Manns politische Biografie eine tiefe Zäsur. Er verließ ihn anders, als er ihn betreten hatte. Sein Status als öffentlicher Widersacher des Nationalsozialismus war unumkehrbar geworden. Wann eine Demokratie zu kippen beginnt und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind – Thomas Mann hatte seine Antwort gefunden.
Über den Autor
Kai Sina ist Literaturwissenschaftler und Inhaber der Lichtenberg-Professur für Transatlantische Literaturgeschichte an der Universität Münster. Er hat sich insbesondere in der Thomas-Mann-Forschung einen Namen gemacht und verbindet in seinen Arbeiten philologische Arbeitweisen mit literarhistorischen und ideengeschichtlichen Perspektiven.
In seinem Buch WAS GUT IST UND WAS BÖSE (Propyläen 2024) beleuchtet er Thomas Manns Rolle als politischer Aktivist. Dabei zeigt er unter anderem, mit welchen medialen Strategien Thomas Mann Widerstand gegen den Nationalsozialismus leistete, und analysiert zugleich dessen fortdauernde und energische Unterstützung des Zionismus.
Image: © Hans Scherhaufer

Über das Buch
Kai Sinas WAS GUT IST UND WAS BÖSE zeichnet ein neues Bild von Thomas Mann als politisch engagiertem Intellektuellen und verfolgt seinen Weg vom Monarchisten zum überzeugten Demokraten und Antifaschisten. Im Fokus steht dabei auch Manns oft übersehene Auseinandersetzung mit dem Zionismus: Das Buch beschreibt seinen Wandel von der anfänglichen Unterstützung jüdischer Assimilation hin zur Befürwortung eines jüdischen Staates nach dem Holocaust. Durch die präzise Analyse von Reden, Essays und seinem politischen Wirken im amerikanischen Exil eröffnet Sina eine neue Perspektive darauf, wie Intellektuelle moralische Überzeugungen in politische Diskurse einbringen und diese prägen können. - Weitere Informationen